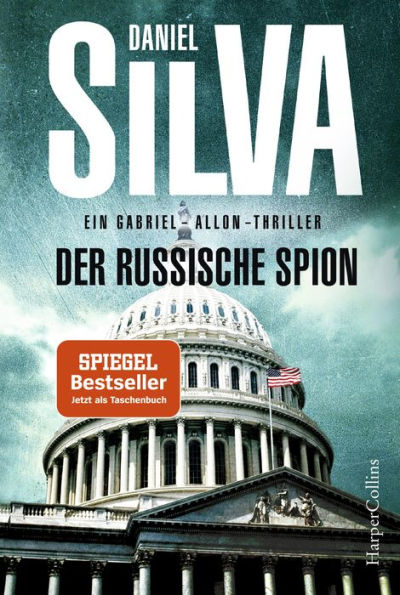eBookGerman-language Edition (German-language Edition)
Related collections and offers
Overview
Gabriel Allon jagt das Vermächtnis des Jahrhundertspions Kim Philby
Eine Routineoperation endet im Chaos: Gabriel Allon und sein Team überwachen zusammen mit Agenten des MI6 einen russischen Überläufer in Wien. Er ist auf dem Weg in ein sicheres Haus der Briten. Doch kurz bevor er das Gebäude erreicht, wird der Mann von einem vermummten Motorradfahrer auf offener Straße hingerichtet. Tags darauf berichten Medien weltweit über den erschossenen Russen und zeigen ein Foto von Gabriel in der Nähe des Tatorts. Allon ist sich sicher: Es muss einen Verräter in den eigenen Reihen geben. Gabriel setzt nun alles daran, ihn zu enttarnen, auch wenn es ihn das Vertrauen seiner Verbündeten kosten sollte.
- »Ein weiteres Juwel in der funkelnden Krone des Meisters der Spionage.« Booklist
- »Auch das 18. Abenteuer der Allon-Reihe kann man nicht mehr aus der Hand legen, denn es ist maßlos spannend.« Hörzu
- »Ein weiterer Zacken in der goldenen Krone des US-Thrillemeisters.« TV Star

Product Details
| ISBN-13: | 9783959678889 |
|---|---|
| Publisher: | HarperCollins Publishers |
| Publication date: | 10/14/2019 |
| Series: | Gabriel Allon (German Language) Series , #18 |
| Sold by: | Libreka GmbH |
| Format: | eBook |
| Pages: | 464 |
| File size: | 4 MB |
| Language: | German |
About the Author

Read an Excerpt
CHAPTER 1
BUDAPEST
Nichts von allem hätte sich ereignen müssen – nicht die verzweifelte Suche nach dem Verräter, nicht die widerwilligen Allianzen, nicht die unnötigen Tode –, wäre der arme Heathcliff nicht gewesen. Er war ihre tragische Gestalt, verkörperte ihr gebrochenes Versprechen. Letzten Endes würde er sich als weitere Kerbe in Gabriels Gewehrkolben erweisen. Trotzdem wäre es Gabriel lieber gewesen, Heathcliff weiter als Aktivposten zu haben. Agenten wie Heathcliff begegnete man nicht täglich, meist in einer Laufbahn nur einmal, selten zweimal. Das lag in der Natur des Spionagegeschäfts, klagte Gabriel manchmal. So war das Leben.
Heathcliff war nicht sein richtiger Name; er sei willkürlich von einem Computer erzeugt worden, behaupteten seine Agentenführer. Das Programm wählte bewusst einen Decknamen, der keine Rückschlüsse auf den wahren Namen, die Nationalität oder den Beruf des Agenten zuließ. In dieser Beziehung hatte es seinen Auftrag erfüllt. Der Mann, dem der Name Heathcliff übergestülpt worden war, war weder ein Findelkind noch ein hoffnungsloser Romantiker. Noch war er verbittert oder nachtragend oder von Natur aus gewalttätig. Tatsächlich hatte er mit Emily Brontës Heathcliff nichts gemeinsam außer seinem dunklen Teint, weil seine Mutter aus der SSR Georgien stammte. Aus derselben Republik, das betonte sie stolz, wie der Genosse Stalin, dessen Porträt noch immer im Wohnzimmer ihres Moskauer Apartments hing.
Heathcliff beherrschte Englisch jedoch in Wort und Schrift und liebte den viktorianischen Roman. Tatsächlich hatte er mit dem Gedanken gespielt, englische Literatur zu studieren, bevor er zur Besinnung gekommen war und sich an der Moskauer Staatlichen Linguistischen Universität eingeschrieben hatte, die unter den angesehensten russischen Universitäten den zweiten Platz belegte. Sein Studienberater war zugleich ein Talentscout des Auslandsnachrichtendiensts SWR, und Heathcliff wurde nach dem Diplom eingeladen, in die SWR-Akademie einzutreten. Seine überglückliche Mutter stellte vor dem Porträt des Genossen Stalin eine Vase mit Blumen auf. »Er wacht über dich«, sagte sie. »Eines Tages wirst du ein Mann, mit dem man rechnen muss. Ein Mann, den man fürchtet.« Seine Mutter fand, für einen Mann gebe es nichts Erstrebenswerteres.
Die meisten Anwärter wollten später in einer Residentura, einer SWR-Station im Ausland, Dienst tun, um dort Agenten anzuwerben und zu führen. Um dabei Erfolg zu haben, musste man ein bestimmter Offizierstyp sein: forsch, selbstbewusst, gesprächig, geistesgegenwärtig, ein geborener Verführer. Heathcliff besaß leider keine dieser Eigenschaften. Und ihm fehlten auch die körperlichen Voraussetzungen für einige der unappetitlichen SWR-Jobs. Seine Stärken waren seine Sprachbegabung – er sprach fließend Deutsch, Holländisch und Englisch – und sein Gedächtnis, das selbst nach den hohen SWR-Standards phänomenal war. Deshalb ließ man ihm die Wahl, was in dem hierarchischen SWR- Kosmos selten war: Er konnte als Übersetzer in der Moskauer Zentrale arbeiten oder als Kurier im Außendienst tätig sein. Er entschied sich für Letzteres, womit er sein Schicksal besiegelte.
Diese Arbeit war nicht glamourös, aber sehr wichtig. Mit seinen vier Sprachen und einem Aktenkoffer voller falscher Pässe bereiste er im Auftrag des Vaterlandes die Welt als heimlicher Botenjunge, als verdeckt arbeitender Postbote. Er leerte tote Briefkästen, stopfte Bargeld in Bankschließfächer und hatte gelegentlich sogar Kontakt mit echten Agenten im Sold der Moskauer Zentrale. Für ihn war es nicht ungewöhnlich, dreihundert Nächte im Jahr außerhalb Russlands zu verbringen, was ihn für eine Ehe oder auch nur eine ernsthafte Beziehung untauglich machte. In Moskau schickte die SWR ihm Gespielinnen – schöne junge Mädchen, die ihn unter normalen Umständen keines Blickes gewürdigt hätten –, aber auf Reisen litt er manchmal anfallsartig unter intensiver Einsamkeit.
Während einer dieser Episoden war er in einer Hamburger Hotelbar seiner Catherine begegnet. Sie trank Weißwein an einem Ecktisch: eine attraktive Mittdreißigerin mit hellbraunem Haar und sonnengebräunten Armen und Beinen. Heathcliff hatte Befehl, auf Dienstreisen solche Frauen zu meiden. Sie waren unweigerlich feindliche Agentinnen oder Prostituierte im Sold ausländischer Dienste. Aber Catherine sah nicht danach aus. Und als sie Heathcliff über ihr Handy hinweg ansah und ihm zulächelte, durchzuckte ihn ein Stromstoß, der von seinem Herzen direkt in seinen Unterleib ging.
»Wollen Sie mir Gesellschaft leisten?«, fragte sie. »Ich trinke nicht gern allein.«
Sie hieß nicht Catherine, sondern Astrid. Zumindest war das der Name, den sie ihm ins Ohr flüsterte, während sie mit einem Fingernagel leicht über die Innenseite seines Oberschenkels fuhr. Sie war Niederländerin, was bedeutete, dass Heathcliff, der sich als russischer Geschäftsmann ausgab, sich in ihrer Muttersprache mit ihr unterhalten konnte. Nach mehreren gemeinsamen Drinks lud sie sich in Heathcliffs Zimmer ein, in dem er sich sicher fühlte. Am Morgen danach wachte er schwer verkatert auf, was für ihn ungewöhnlich war – und ohne sich an einen Liebesakt erinnern zu können. Astrid hatte inzwischen schon geduscht und war in einen Frotteebademantel gewickelt. Bei Tageslicht war ihre bemerkenswerte Schönheit noch augenfälliger.
»Bist du heute Abend frei?«, fragte sie.
»Ich sollte nicht.«
»Warum nicht?«
Er wusste keine Antwort.
»Aber du musst mich richtig ausführen. Zu einem schönen Dinner. Anschließend vielleicht in eine Disco.«
»Und dann?«
Sie öffnete ihren Bademantel, ließ zwei perfekt geformte Brüste sehen. Trotz aller Mühe konnte Heathcliff sich jedoch nicht daran erinnern, sie liebkost zu haben.
Sie tauschten ihre Handynummern aus, was ebenfalls verboten war, und trennten sich. An diesem Tag hatte Heathcliff in Hamburg zwei Aufträge zu erledigen, die mehrere Stunden »Reinemachen« erforderten, bis feststand, dass er nicht beschattet wurde. Als er den zweiten Auftrag beendete – die routinemäßige Leerung eines toten Briefkastens –, erhielt er eine SMS mit dem Namen eines schicken Restaurants an der Alster. Bei seiner Ankunft zur vereinbarten Zeit saß Astrid bereits strahlend an ihrem Tisch und hatte eine grässlich teure Flasche Montrachet geöffnet vor sich. Heathcliff runzelte die Stirn; diesen Wein würde er selbst bezahlen müssen. Die Moskauer Zentrale kontrollierte seine Abrechnungen sorgfältig und tadelte jede Überschreitung seines Spesensatzes.
Astrid schien sein Unbehagen zu spüren. »Keine Sorge, heute lade ich ein.«
»Ich dachte, ich sollte dich richtig ausführen.«
»Habe ich das wirklich gesagt?«
In diesem Augenblick wurde Heathcliff klar, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht hatte. Sein Instinkt riet ihm zur Flucht, aber er wusste, dass ihm das nichts nützen würde; sein Schicksal war besiegelt. Also blieb er in dem Restaurant und dinierte mit der Frau, die ihn verraten hatte. Ihre Unterhaltung war stockend und gestelzt – der Stoff eines schlechten TV- Dramas –, und als die Rechnung kam, zahlte Astrid. Natürlich in bar.
Draußen wartete eine Limousine. Heathcliff erhob keine Einwände, als Astrid ihn ruhig aufforderte, mit ihr hinten einzusteigen. Er protestierte auch nicht, als die Fahrt von seinem Hotel wegführte. Der Fahrer war offensichtlich ein Profi; er sprach kein Wort, während er mit mehreren Tricks aus dem Lehrbuch sicherstellte, dass sie nicht verfolgt wurden. Astrid verbrachte die Zeit damit, Textnachrichten zu verschicken und zu empfangen. Mit Heathcliff wechselte sie kein Wort.
»Haben wir uns eigentlich ...«
»Geliebt?«, fragte sie.
»Ja.«
Sie starrte aus dem Fenster.
»Gut«, sagte er. »So ist's besser.«
Ihr Bestimmungsort war ein kleines Haus am Meer. Drinnen wartete ein Mann, der Heathcliff in deutsch gefärbtem Englisch ansprach. Er stellte sich als Marcus vor und sagte, er arbeite für einen westlichen Geheimdienst, dessen Namen er nicht nannte. Dann legte er Heathcliff mehrere streng geheime Schriftstücke vor, die Astrid letzte Nacht aus seinem abgeschlossenen Aktenkoffer kopiert habe, während er von ihren K.-o.-Tropfen bewusstlos gewesen sei. Heathcliff werde weitere Dokumente dieser Art liefern, sagte Marcus, und noch viel, viel mehr. Sonst würden Marcus und seine Kollegen dieses Material dazu benutzen, Heathcliff bei der Moskauer Zentrale als Spion zu denunzieren.
Anders als sein Namensvetter war Heathcliff weder verbittert noch nachtragend. Er kehrte eine halbe Million Dollar reicher nach Moskau zurück und wartete auf seinen nächsten Auftrag. Die SWR schickte ihm ein schönes junges Mädchen in sein Apartment auf den Sperlingsbergen. Als sie sich als Ekaterina vorstellte, wurde Heathcliff vor Angst fast ohnmächtig. Er machte ihr ein Omelett und schickte sie unberührt fort.
Die Lebenserwartung eines Mannes in Heathcliffs Position war nicht hoch. Auf Verrat stand die Todesstrafe. Aber ihn erwartete kein schneller, sondern ein qualvoller Tod. Wie alle SWR- Angehörigen hatte Heathcliff viele Geschichten gehört. Auch von erwachsenen Männern, die um eine Kugel gebettelt hatten, die ihre Leiden beenden würde. Irgendwann würde sie kommen – nach russischer Art als Genickschuss. Wysschaja mera,» Höchststrafe«, nannte die SWR diese Hinrichtungsart. Heathcliff war entschlossen, ihnen niemals in die Hände zu fallen. Von Marcus ließ er sich eine Zyankalikapsel besorgen. Ein kräftiger Biss würde genügen. Zehn Sekunden, dann war alles vorbei.
Von Marcus bekam Heathcliff auch einen Geheimsender, mit dem er Berichte via Satellit als verschlüsselte Microbursts absetzen konnte. Heathcliff benutzte ihn jedoch selten, weil er es vorzog, sich auf seinen Auslandsreisen mit Marcus zu treffen. Dabei ließ er Marcus den Inhalt seines Aktenkoffers fotografieren, aber vor allem redeten sie miteinander. Heathcliff war kein wichtiger Mann, aber er arbeitete für wichtige Männer und transportierte ihre Geheimnisse. Außerdem kannte er russische tote Briefkästen in aller Welt, deren Koordinaten sein Ausnahmegedächtnis bereithielt. Heathcliff hütete sich davor, zu viel zu schnell preiszugeben – um seiner selbst und seines rasch anwachsenden Bankkontos willen. Aus einer halben Million wurde binnen eines Jahres eine Million. Dann zwei. Und dann drei.
Heathcliffs Gewissen blieb rein – er war ein Mann ohne ideologische oder politische Überzeugungen –, aber er hatte Tag und Nacht Angst. Er fürchtete, die Moskauer Zentrale wisse von seinem Verrat und überwache ihn auf Schritt und Tritt. Er fürchtete, ein Geheimnis zu viel verraten zu haben oder in Gefahr zu sein, von einem der Spione des Zentrums im Westen verraten zu werden. Bei zahlreichen Gelegenheiten drängte er Marcus, ihn aus der Kälte heimzuholen. Marcus weigerte sich jedoch – manchmal mit etwas beruhigendem Balsam, manchmal mit Peitschenknallen. Heathcliff sollte weiterspionieren, bis sein Leben tatsächlich in Gefahr war. Erst dann würde er überlaufen dürfen. Er zweifelte zu Recht an Marcus' Fähigkeit, den exakten Zeitpunkt vorherzusehen, an dem das Schwert herabstoßen würde, aber ihm blieb nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Marcus hatte ihn durch Erpressung gefügig gemacht. Und Marcus würde ihm seine letzten Geheimnisse abpressen, bevor er ihn aus seiner Knechtschaft entließ.
Aber nicht alle Geheimnisse sind gleich wertvoll. Manche sind banal, alltäglich, und können ohne große Gefahr für den Überbringer weitergegeben werden. Andere sind jedoch viel zu gefährlich, um verraten werden zu können. Ein Geheimnis dieser Art fand Heathcliff letztlich in einem toten Briefkasten im fernen Montreal. In Wirklichkeit war der Briefkasten eine leer stehende Wohnung, die ein russischer Illegaler, der als Schläfer in den Vereinigten Staaten lebte, gemietet hatte. In dem Schrank unter dem Küchenspülbecken war ein USB-Stick versteckt. Heathcliff hatte den Auftrag, ihn quasi unter den Augen der mächtigen amerikanischen National Security Agency abzuholen und in die Moskauer Zentrale zurückzubringen. Bevor er die Wohnung verließ, steckte er den USB-Stick in sein Notebook und sah erstaunt, dass der Inhalt unverschlüsselt war. So konnte Heathcliff nach Belieben in den Schriftstücken blättern. Sie stammten von verschiedenen amerikanischen Geheimdiensten und waren ausnahmslos als Top Secret eingestuft.
Heathcliff wagte nicht, das Material zu kopieren. Stattdessen speicherte er alle Details in seinem phänomenalen Gedächtnis und kehrte in die Moskauer Zentrale zurück, in der er den USB-Stick seinem Führungsoffizier übergab, wobei er das Versäumnis des Illegalen, den Inhalt zu verschlüsseln, scharf rügte. Der Agentenführer, ein Mann namens Wolkow, versprach ihm, sich darum zu kümmern. Dann bot er Heathcliff als Belohnung einen stressarmen Ausflug nach Budapest an. »Sozusagen ein All- inclusive-Urlaub auf Kosten der Zentrale. Nimm's mir nicht übel, Konstantin, aber du siehst aus, als hättest du etwas Erholung nötig.«
Am selben Abend benutzte Heathcliff den Geheimsender, um Marcus mitzuteilen, er habe ein so wichtiges Geheimnis entdeckt, dass ihm keine andere Wahl bleibe, als überzulaufen. Zu seiner großen Überraschung erhob Marcus keine Einwände. Er wies Heathcliff an, den Sender so zu entsorgen, dass er nie gefunden werden würde. Heathcliff zertrümmerte ihn und warf die Bruchstücke in einen Gully. Dort würden ihn selbst die Bluthunde der SWR-Hauptverwaltung mit Sicherheit nicht suchen, rechnete er sich aus.
Nach einem letzten Besuch bei seiner Mutter in ihrer winzigen Wohnung, die von dem finsteren Porträt des stets wachsamen Genossen Stalin beherrscht wurde, verließ Heathcliff Russland endgültig. Am Spätnachmittag traf er bei leichtem Schneefall in Budapest ein und nahm ein Taxi zum Hotel Intercontinental. Dort bekam er ein Zimmer mit Donaublick. Er schloss seine Tür zweimal ab und hakte die Sicherungskette ein, dann setzte er sich an den Schreibtisch und wartete darauf, dass sein Handy klingeln würde. Daneben lag Marcus' Zyankalikapsel. Ein kräftiger Biss würde genügen. Zehn Sekunden. Dann würde alles vorbei sein.
CHAPTER 2WIEN
Zweihundertfünfzig Kilometer nordwestlich, weniger als drei Autostunden entfernt, näherte eine Ausstellung mit Werken von Peter Paul Rubens – Künstler, Gelehrter, Diplomat, Spion – sich allmählich ihrem melancholischen Ende. Die mit Bussen herangekarrten Horden waren wieder verschwunden, und an diesem Spätnachmittag waren nur mehr wenige Stammbesucher des alten Museums zögernd in seinen rosenfarbenen Sälen unterwegs. Einer von ihnen war ein Mann in späten mittleren Jahren. Er begutachtete die riesigen Leinwände mit üppigen Akten in ausschweifenden historischen Szenen unter dem Schirm einer flachen Mütze hervor, die er tief in die Stirn gezogen trug.
Schräg hinter ihm stand ein jüngerer Mann, der ungeduldig auf seine Armbanduhr sah. »Wie lange noch, Boss?«, fragte er sotto voce auf Hebräisch. Der Angesprochene antwortete jedoch auf Deutsch – und laut genug, damit der gelangweilte Aufseher in einer Ecke ihn hören konnte. »Danke, ich möchte mir nur noch ein Gemälde ansehen, bevor ich gehe.«
Er ging in den nächsten Saal weiter und blieb vor einer Madonna mit Kind, Öl auf Leinwand, 137 x 111 cm, stehen. Dieses Gemälde kannte er sehr gut: Er hatte es in West Cornwall in einem Cottage am Meer restauriert. Jetzt ging er leicht in die Knie, um die Oberfläche bei schräg einfallendem Licht zu begutachten. Seine Arbeit hatte sich gut gehalten. Wenn ich das nur auch von mir sagen könnte, dachte er, indem er sich die feurig schmerzende Stelle in seinem Kreuz rieb. Die beiden gebrochenen Rückenwirbel waren seine neueste Verwundung. In seiner langen, ruhmreichen Laufbahn als Agent des israelischen Geheimdiensts war Gabriel zweimal in die Brust geschossen, von einem wachsamen Schäferhund angefallen und in der Moskauer Lubjanka mehrere Treppen hinuntergestoßen worden. Nicht einmal Ari Schamron, sein legendärer Mentor, konnte mit so vielen Verwundungen konkurrieren.
Sein jüngerer Begleiter, der Gabriel durch die Säle des Museums folgte, hieß Oren. Er befehligte Gabriels Personenschützer – eine unerwünschte Folge einer kürzlichen Beförderung. Sie waren seit sechsunddreißig Stunden auf Reisen: erst mit dem Flugzeug von Tel Aviv nach Paris, dann mit dem Auto von Paris nach Wien. Jetzt gingen sie durch die leeren Bildersäle zum Ausgang des Museums. Draußen hatte es zu schneien begonnen, große, lockere Flocken, die in der windstillen Nacht senkrecht herabschwebten. Ein gewöhnlicher Tourist hätte das Bild, wie die Trambahnen auf überzuckerten Straßen an leeren Kirchen und Palästen vorbeiglitten, malerisch finden können. Nicht jedoch Gabriel. Wien deprimierte ihn jedes Mal, vor allem bei Schneefall.
Am Randstein stand ihre Limousine mit dem Fahrer am Steuer. Gabriel klappte den Kragen seiner alten Barbour-Jacke hoch und erklärte Oren, er wolle zu Fuß zu der sicheren Wohnung zurückgehen.
(Continues…)
Excerpted from "Der russische Spion"
by .
Copyright © 2019 Daniel Silva.
Excerpted by permission of HarperCollins Germany GmbH.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.